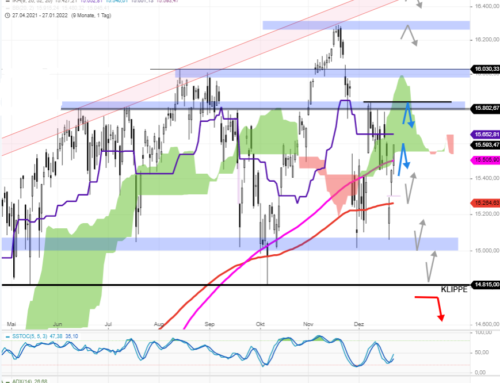Die Sorgen vor langfristig höheren Verbraucherpreisen nehmen auch in der Eurozone zu, der Tiefpunkt der Rating-Entwicklung am Markt für europäische Unternehmensanleihen dürfte durchschritten sein, und die Kupferpreise an der Londoner Metallbörse geben nach.
Keine schnelle Leitzinswende im Euroraum
Die Sorgen vor langfristig höheren Verbraucherpreisen haben auch in der Eurozone deutlich zugenommen. Die aus Swap-Termingeschäften abgeleitete Erwartung für die Fünf-Jahres-Inflation in fünf Jahren liegt aktuell bei fast 1,6 Prozent – der höchste Wert seit rund zweieinhalb Jahren. Dementsprechend wird am Markt für 2023 bereits eine Leitzinserhöhung von zehn Basispunkten in der Eurozone eingepreist. Dieses Szenario halte ich allerdings für ambitioniert. Laut der Europäischen Zentralbank (EZB) kommt eine Leitzinserhöhung erst in Frage, wenn zuvor die Anleihekäufe beendet wurden. Während das Pandemic Emergency Purchase Programme (PEPP) wahrscheinlich im März 2022 ausläuft, dürfte die EZB ihre Ankäufe im Rahmen der anderen bestehenden Programme fortsetzen. Denn um das Risiko von Marktturbulenzen zu minimieren, wird der Erwerb von Bonds in der Regel über einen längeren Zeitraum langsam zurückgefahren. Das letzte Mal hat dieses sogenannte Tapering bei der EZB zwei Jahre gedauert. Eine Leitzinserhöhung vor 2024 erscheint somit unwahrscheinlich.
Bonität von Anleihen verbessert sich
Der Tiefpunkt der Rating-Entwicklung am Markt für europäische Unternehmensanleihen dürfte durchschritten sein. Im April wurden mit einem Volumen von 19,1 Milliarden Euro so viele „Investment Grade“-Anleihen heraufgestuft wie noch nie seit Ausbruch der Pandemie. Bei den „High Yield“-Anleihen waren es 6,2 Milliarden Euro – der fünfte Monat in Folge mit einer positiven Rating-Entwicklung. Auch dank staatlicher Liquiditätshilfen war die Drei-Monats-Ausfallquote bei „High Yields“ im Verlauf der Pandemie stets deutlich niedriger als in der Weltfinanzkrise. Nach einem zyklischen Hoch bei knapp zehn Prozent liegt sie inzwischen mit rund zwei Prozent wieder auf Vorkrisenniveau. Der positive Rating-Trend könnte sich fortsetzen, da sich die Ertrags- und Verschuldungszahlen europäischer Unternehmen im Zuge der erwarteten Konjunkturerholung weiter verbessern sollten. Dennoch halte ich das Kurspotenzial bei europäischen Unternehmensanleihen angesichts der bereits sehr niedrigen Renditeaufschläge für begrenzt.
„Carbon Capture“ wird wirtschaftlicher
Bereits 2005 betonte der Zwischenstaatliche Ausschuss für Klimaänderungen (IPCC) in einem über 400 Seiten starken Sonderbericht das Potenzial der Abscheidung und Speicherung von Kohlenstoffdioxid (engl. Carbon Capture and Storage; CCS) im Kampf gegen den Klimawandel. Dennoch sind heute weltweit nicht einmal 30 Produktionsstätten mit CCS-Anlagen ausgestattet. Hauptgrund hierfür ist, dass die durchschnittlichen Kosten für die Anschaffung und den Betrieb von Abscheidungsanlagen in Höhe von 60 bis 120 US-Dollar je Tonne bisher meist weit über den Emissionskosten lagen. Mittlerweile erscheint CCS jedoch deutlich wirtschaftlicher. Denn die europäischen CO2-Preise sind zuletzt auf über 65 US-Dollar geklettert und könnten mittelfristig weiter steigen.
Zudem planen Republikaner und Demokraten in den USA, die Steuergutschriften pro gespeicherte Tonne festes CO2 von bisher 50 auf 85 US-Dollar anzuheben. Führende CCS-Entwickler sind außerdem optimistisch, dass sie die Anschaffungs- und Betriebskosten ihrer Anlagen bis 2025 halbieren können. Diese Aussichten stimmen mich zuversichtlich, dass die Investitionen in CCS mittelfristig deutlich anziehen und Aktien der Branche langfristigen Aufwind bescheren werden.
Anhaltendes Angebotsdefizit bei Kupfer
Die Kupferpreise an der Londoner Metallbörse gaben von ihren am 10. Mai gehandelten Rekordhochs gut sieben Prozent ab. Verantwortlich hierfür ist das Bestreben offizieller Stellen in China, den Preisanstieg des roten Metalls zu bremsen, indem unter anderem Handelsbeschränkungen für die Schanghaier Börse erlassen wurden. Für weiterhin steigende Preise des weltweit in US-Dollar gehandelten Kupfers spricht aber nicht nur der momentane Abwärtstrend des US-Dollars; gegenüber dem Renminbi beispielsweise handelt der Greenback auf einem Drei-Jahres-Tief. Auch ein prognostiziertes Angebotsdefizit für die Jahre 2021 bis 2023 dürfte die Kupferpreise stützen. Analysten erwarten, dass die großen Kupferproduzenten in Chile, Peru und Sambia mit höheren Steuersätzen auf Kupferumsätze belegt werden dürften. Dadurch könnten anstehende Investitionen in neue Minen in Höhe von rund 50 Milliarden US-Dollar zumindest verzögert werden. Die Kupferrally könnte somit zwar an Dynamik verlieren, die Preise aber gegen zu starke Rücksetzer abgesichert sein.