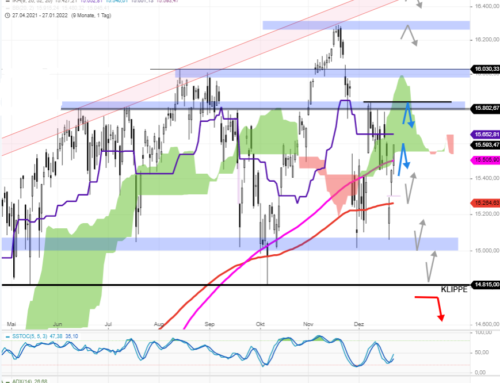Die Inflationsraten für Deutschland im Monat November überraschen erneut, die ambitionierten Klimaziele der „Ampel-Koalition“ eröffnen Wachstumschancen für die Energiewirtschaft in Deutschland, und die chinesische Politik will den Abschwung am Immobilienmarkt bremsen.
Deutschland: Inflation bleibt hoch
Die gestern veröffentlichten Inflationsraten für Deutschland im Monat November überraschten erneut: Mit 5,2 Prozent stiegen sie so stark wie seit 1992 nicht mehr. Schaut man auf den für die Europäische Zentralbank (EZB) relevanten Harmonisierten Verbraucherpreisindex, verteuerte sich der entsprechende Warenkorb sogar um sechs Prozent zum Vorjahr. Obwohl die Inflationsrate im kommenden Jahr wegen auslaufender Sondereffekte zurückgehen sollte, wies unter anderem die Bundesbank in ihrem letzten Monatsbericht darauf hin, dass sie für längere Zeit über drei Prozent verbleiben könnte. Die EZB wird auf ihrer Pressekonferenz in rund zwei Wochen in ihrer Kommunikation mit Bedacht vorgehen. Sie dürfte sowohl den Preisdruck – der in der Eurozone weit höher ist als bisher angenommen – als auch die Konjunkturrisiken – die durch die in vielen Ländern auferlegten, wachstusdämpfenden Corona-Restriktionen entstehen – adressieren müssen. EZB-Präsidentin Christine Lagarde gab zuletzt in einem Interview an, dass sie trotz des aktuell hohen Preisdrucks allerdings weiterhin davon ausgeht, dass die Inflationsraten in der Eurozone mittelfristig unter das EZB-Ziel von zwei Prozent fallen werden. Die Bewegung von Renditen deutscher Bundesanleihen mit längerer Laufzeit erwarte ich in den kommenden Wochen in diesem Umfeld weiter volatil.
Energiebranche profitiert von Plänen der „Ampel-Koalition“
Die ambitionierten Klimaziele der „Ampel-Koalition“ eröffnen Wachstumschancen für die Energiewirtschaft in Deutschland. Damit eine Reduktion der CO2-Emissionen um 55 Prozent bis 2030 erreicht werden kann, soll der Anteil Erneuerbarer Energien bei Heizungen – nach heutigem Stand im Wesentlichen strombetriebene Wärmepumpen – auf 50 Prozent gesteigert werden. Gleichzeitig sollen Ende des Jahrzehnts 15 Millionen Elektrofahrzeuge auf deutschen Straßen rollen. Um den damit verbundenen Anstieg des Strombedarfs um voraussichtlich rund 50 Prozent zu decken, müssen bis 2030 schätzungsweise fast 200 Milliarden Euro in neue Fotovoltaik- und Windanlagen investiert werden. Hinzu kommen erhebliche Ausgaben für den Ausbau der Stromnetze, was die „Ampel-Koalition“ durch verbesserte Investitionsbedingungen unterstützen möchte. Neben Anlagenbauern zählen Energieversorger und Netzbetreiber zu den Profiteuren der Energiewende in Deutschland. Ich sehe auf lange Sicht Kurschancen, obwohl wieder aufflammende Pandemie-Sorgen sowie steigende Zinsen insbesondere für Versorger zunächst noch Gegenwind bedeuten könnten.
USA: Strafzölle im Visier
Auch auf US-Präsident Joe Biden steigt der Druck, der Inflation in den Vereinigten Staaten Einhalt zu gebieten. Neben der Freisetzung strategischer Ölreserven rücken die unter dem ehemaligen Präsidenten Donald Trump auferlegten Strafzölle auf Importe aus China zunehmend in den Fokus der US-Handelskammer und der Unternehmen. Die Zölle, die weitgehend auf Stahl- und Aluminium-Produkte anfallen, betreffen Güter im Wert von rund 350 Milliarden US-Dollar. Die gesellschaftlichen Kosten werden auf bis zu 50 Milliarden US-Dollar pro Jahr beziffert. Gemeinsam mit chinesischen Gegenmaßnahmen verteuern die Tarife den Handel zwischen den beiden Ländern, reduzieren die Güterströme und tragen damit zur Inflation bei. Zwar scheint eine unmittelbare Rückführung der Maßnahmen unwahrscheinlich, im kommenden Jahr könnte sie den Demokraten aber wichtige Stimmen bei den Zwischenwahlen einheimsen. Analysten zufolge dürfte sich die Aufhebung der Strafzölle auch positiv auf die Gewinne der S&P-500-Konzerne auswirken.
Steigende Umsätze und Margen wären das Resultat, die das für 2022 erwartete Gewinnwachstum um gut 50 Prozent anheben könnten. Dies würde die durchschnittliche Bewertung der Unternehmen gemessen am Kurs-Gewinn-Verhältnis auf Basis der erwarteten Gewinne des kommenden Jahres von 21,6 auf 20,7 drücken.
China stützt den Immobilienmarkt
Die chinesische Politik unternimmt weitere Schritte, um den Abschwung am Immobilienmarkt zu stoppen. Vergangene Woche hat Chengdu als erste Metropole Erleichterungen für Immobilienentwickler verkündet; unter anderem sollen der Verkauf von Wohnungen und die Kreditaufnahme schneller genehmigt werden. Zuvor hatten schon einige chinesische Städte die Veräußerung von Bauland vereinfacht. Gleichzeitig sollen lokale Gebietskörperschaften mehr Anleihen zur Finanzierung von Immobilienprojekten begeben. Zwar mahne ich vor allzu großer Euphorie – die Maßnahmen wirken nicht sofort, typischerweise dauern Abschwünge am chinesischen Immobilienmarkt drei bis vier Quartale. Dennoch sendet die Politik ein wichtiges Signal in Richtung einer konjunkturellen Stabilisierung. Der Immobilienmarkt steht immerhin für etwa 30 Prozent der Wirtschaftsleistung in China. Die Aktien einiger zuletzt schwer gebeutelter Immobilienentwickler sind nach der Entscheidung gestiegen. Von einer Stabilisierung des Immobilienmarktes könnte wegen der damit verbundenen positiven Wachstumseffekte aber letztendlich der ganze chinesische Aktienmarkt profitieren.