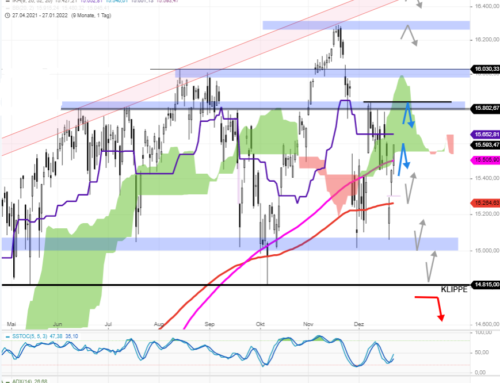EZB-Chefin Christine Lagarde äußert sich zur anziehenden Inflation, US-Nebenwerte des Russell 2000 fallen hinter den S&P 500 zurück, und taiwanische Firmen tätigen höhere Direktinvestitionen im Ausland.
Europäische Zentralbank äußert sich zur steigenden Inflation
Morgen kommen die Ratsmitglieder der Europäischen Zentralbank (EZB) zusammen, um über die zukünftige Geldpolitik im Euroraum zu entscheiden. Ich erwarte keine Anpassung der geldpolitischen Strategie, allerdings wird mit Spannung zu beobachten sein, wie EZB-Präsidentin Christine Lagarde bei der abschließenden Pressekonferenz die ökonomischen Abwärtsrisiken auf der einen und die gestiegenen Inflationsraten und -erwartungen auf der anderen Seite kommentiert. Die Renditen von Staatsanleihen aus der Eurozone haben die Entwicklung der gestiegenen Inflationsraten jedenfalls bereits groß teils eingepreist. Deutsche Bundesanleihen mit zehnjähriger Laufzeit rentierten zuletzt wieder deutlich höher und näherten sich der Null-Prozent-Marke. Hinweise auf eine zukünftig restriktivere Geldpolitik könnten der Aufwärtsbewegung weiteren Schwung geben und dem Euro, der zuletzt gegenüber dem US-Dollar schwächelte, wieder Auftrieb verschaffen.
Gesundheitsbranche bremst US-Nebenwerteindex
Für den US-Nebenwerteindex Russell 2000 ging es seit Mitte Februar in Euro gerade einmal fünf Prozent bergauf, während der S&P 500 um rund 22 Prozent stieg.
Dies ist insbesondere auf die schwache Entwicklung des Gesundheitssektors mit minus 21 Prozent zurückzuführen, die das Kursplus von Finanz- mit 22 Prozent und Grundstofftiteln mit 21 Prozent auf wog. Die Gesundheitsbranche steht für fast ein Fünftel des Index und enthält viele Biotechnologieunternehmen, die unter anderem wegen unterbrochener Medikamentenstudien und Unsicherheiten rund um den zukünftigen Vorsitz der US-Behörde für Lebens- und Arzneimittel FDA unter Druck stehen. Vorausschauend könnte es den Nebenwerten schwerfallen, aus der Seitwärtsbewegung auszubrechen. Denn angesichts potenziell steigender Kapitalmarktzinsen dürfte die Rekord Verschuldung der Unternehmen wieder vermehrt in den Anlegerfokus rücken. Zudem verfügen kleine Unternehmen im Vergleich zu Großkonzernen über weniger Spielraum für Preisanhebungen, und Löhne stellen einen größeren Teil der Gesamtkosten dar. Angesichts von Lieferkettenengpässen und steigenden Lohnforderungen könnten Marktteilnehmer deshalb kurzfristig eher zurückhaltend bleiben. Langfristig bewerte ich Nebenwerte jedoch weiter als chancenreich.
China: Nachfrage nach Investmentfonds steigt
Das in China verwaltete Investmentfondsvermögen belief sich Ende August 2021 auf umgerechnet rund 3,75 Billionen US-Dollar – ein Zuwachs von 20 Prozent in acht Monaten. Dies dürfte auch den zunehmend volatilen Preisen von Immobilien und Vermögensverwaltungsprodukten geschuldet sein. Sie stellen neben Aktien und dem Sparbuch die bisher traditionellen Formen des Vermögensaufbaus und der Altersvorsorge der Chinesen dar. Denn das Fehlen eines staatlichen Altersvorsorgesystems wie beispielsweise in Europa ist ein entscheidender Grund für das Engagement chinesischer Haushalte am Kapital- und am Immobilienmarkt. Zum Teil sinkende Immobilienpreise sowie die erwartete Vermögenssteuer auf Immobilien könnten zukünftig für eine schrittweise Verlagerung der Vermögenspositionen der Kleinanleger von Immobilien zu Aktien und Investmentfonds sorgen. Strukturelles Wachstumspotenzial dürfte vorhanden sein: Der Anteil der Kleinaktionäre in China sank in den knapp 20 Jahren des Immobilienbooms von 90 Prozent auf aktuell nur noch 52 Prozent. Aussichten auf ein Umschlagen des Pendels haben unter anderem große internationale Fondsgesellschaften zum Markteintritt bewegt, mit möglichem Kurspotenzial ihrer Aktien. Bei chinesischen Aktien rate ich infolge bestehender wirtschaftlicher Unsicherheiten zunächst weiter zu Vorsicht, auch wenn die möglichen Kapitalzuflüsse aus dem Immobilienmarkt mittelfristig die Kurse stützen könnten.
Taiwanische Firmen investieren im Ausland
Die Direktinvestitionen taiwanischer Firmen im Ausland (ausgenommen Festlandchina) stiegen in den ersten neun Monaten des Jahres um 33 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum auf insgesamt knapp neun Milliarden US-Dollar. Diese Tendenz könnte künftig an Dynamik gewinnen, da allein Taiwans große Halbleiterunternehmen für 2021 und 2022 ausländische Direktinvestitionen von mindestens 20 Milliarden US-Dollar angekündigt haben. Gleichzeitig könnte dies auf eine zunehmende Kooperationsbereitschaft der Halbleiterindustrie Taiwans bei der Verlagerung von Know-how und Produktion ins Ausland hindeuten. Im Vergleich zum gesamten bis 2023 geplanten Investitionsvolumen der Schlüsselbranche von 170 Milliarden US-Dollar sind diese Investitionen aber lediglich ein Tropfen auf dem heißen Stein. Die Konkurrenz in China, in den USA und in Europa dürfte selbst bei Investitionen im dreistelligen Milliardenbereich rund fünf Jahre benötigen, um insbesondere bei der Fertigung der für die 5G-Technologien unverzichtbaren fünf Nanometer großen und noch kleineren Chips aufzuschließen. Dies sind grundsätzlich positive Aussichten für Taiwans Chiphersteller. Anleger sollten jedoch auch mögliche Kursrisiken berücksichtigen, die von Chinas zuletzt häufiger artikulierten Expansionsbestrebungen im Chinesischen Meer ausgehen können.