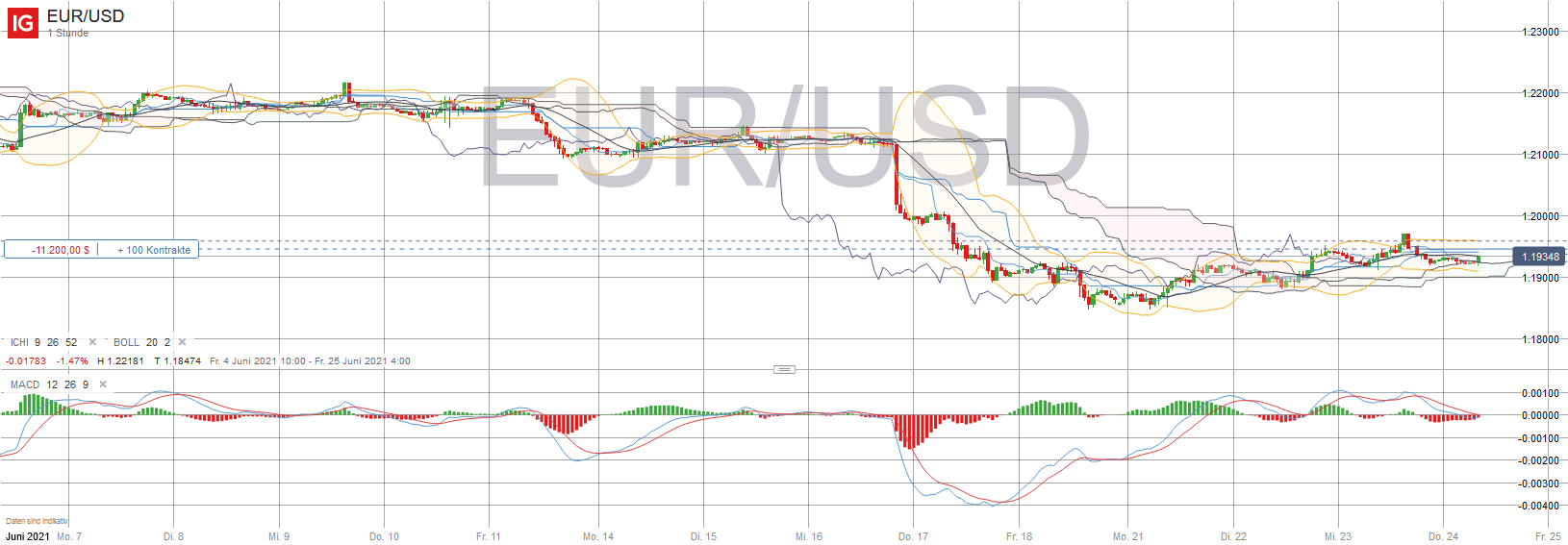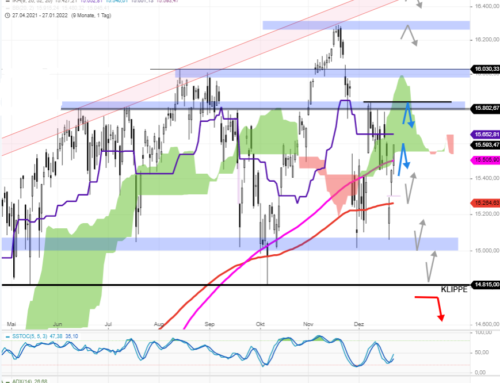Die Auswirkungen des Brexits auf die Realwirtschaft dürften sich erst in den kommenden Quartalen in aller Deutlichkeit zeigen, der private Konsum ist ein wesentlicher Treiber der Erholung nach dem Abflauen der Pandemie, und die Transportkosten für Schiffsfracht sind ein wesentlicher Treiber der deutlich ansteigenden Erzeugerpreise.
Fünf Jahre Brexit-Votum
Am 23. Juni 2016 hatte das britische Volk das Wort und entschloss sich zum Austritt aus der Europäischen Union (EU). Da das Handelsabkommen erst zu Beginn des Jahres 2021 und somit mitten in der zweiten Welle der Coronavirus-Pandemie in Kraft trat, dürften sich die Auswirkungen auf die Realwirtschaft erst in den kommenden Quartalen in aller Deutlichkeit zeigen. Dank des sehr erfolgreichen Starts der Covid-19-Impfkampagne ist das Pfund Sterling 2021 zwar nach dem Kanadischen Dollar die bis dato stärkste aller G10-Währungen. Betrachtet man allerdings den Zeitraum seit dem Brexit-Votum, entwickelte sich keine andere schlechter. Das Pfund Sterling verlor 6,1 Prozent zum US-Dollar und rund zehn Prozent zum Euro. Der FTSE-100-Leitindex der Londoner Börse notiert inklusive Dividenden fünf Jahre nach dem Votum in Britischen Pfund berechnet rund 35 Prozent höher. Der EURO STOXX 50 und der DAX legten im selben Zeitraum allerdings jeweils um mehr als 50 Prozent zu. Die Underperformance britischer Anlagen könnte sich trotz eines erwarteten starken Konjunkturaufschwungs weiter fortsetzen, sofern sich die ökonomischen Folgen des Brexits – wie ein schwächerer Außenhandel und Arbeitskräftemangel infolge geringeren Zuzugs aus der EU – stärker manifestieren werden.
Autoverkäufe steigen
Der private Konsum ist ein wesentlicher Treiber der Erholung nach dem Abflauen der Pandemie. In der Eurozone dürften höhere Ausgaben der Verbraucher in diesem Jahr etwa ein Viertel und 2022 über die Hälfte zum Wachstum des Bruttoinlandsproduktes von voraussichtlich jeweils gut vier Prozent beitragen. Weil in der Krise weniger konsumiert wurde und die Sparquote von 12,5 Prozent auf bis zu knapp 20 Prozent des verfügbaren Einkommens angestiegen ist, verfügen die Privathaushalte über zusätzliche finanzielle Reserven in Höhe von schätzungsweise 550 bis 650 Milliarden Euro – etwa fünf Prozent der Wirtschaftsleistung im Euroraum. Im Zuge stark rückläufiger Infektionszahlen in den meisten Mitgliedsländern dürfte die Konsumfreude schnell zurückkehren. Besonders großes Wachstumspotenzial sehe ich bei langlebigen Gebrauchsgütern wie zum Beispiel Autos. Die Pkw-Neuzulassungen lagen in der Eurozone im ersten Halbjahr 2021 immer noch um ein Viertel unter Vorkrisenniveau, während in den USA schon wieder mehr Fahrzeuge zugelassen wurden als 2019. Das sind gute Rahmenbedingungen für europäische Autohersteller, deren Verkaufszahlen und Erträge in den kommenden Quartalen ordentlich zulegen könnten.
Frachtraten weiterhin teuer
Die ungewöhnlich hohen Transportkosten für Schiffsfracht sind ein wesentlicher Treiber der rund um den Globus deutlich ansteigenden Erzeugerpreise. Das mangelnde Angebot an Containern und die pandemiebedingten Einschränkungen an einigen der weltgrößten Häfen besonders in Asien treiben die Kosten immer weiter in die Höhe. Der Transport eines 40-Fuß-Containers von Schanghai nach Rotterdam verteuerte sich binnen Jahresfrist um 430 Prozent, da dies die Hauptroute für Exporte Chinas Richtung Europa ist. In der Gegenrichtung stiegen die Preise „nur“ um rund 30 Prozent, da manche Container leer zurück transportiert werden.
Beides ist jedoch ein Preisniveau, das zuletzt vor zehn Jahren erzielt wurde. Auch auf der Atlantikroute kletterte der Preis für den Transport von Rotterdam nach New York um mehr als 50 Prozent beziehungsweise für die Gegenroute um rund 80 Prozent auf den höchsten Stand seit 2011. Infolgedessen notieren Aktien europäischer Reedereien zurzeit 120 Prozent über ihrem Vorjahresniveau, verglichen mit etwa 25 Prozent Kurssteigerung des EURO STOXX 50. Die Rally könnte noch etwas anhalten, mittelfristig dürfte sich jedoch die Situation entspannen und die Frachtraten wieder sinken.
Aluminium bleibt teuer
Aluminium hat sich an der Londoner Metallbörse in diesem Jahr mit rund 22 Prozent nach Zink am stärksten verteuert. Zwar dürfte China ab Juli Kupfer, Zink und Aluminium aus den staatlichen Reserven in den Markt geben. Allerdings ist die geplante erste Tranche von 50.000 Tonnen Aluminium nicht sonderlich groß und bereits eingepreist. Zudem deckt sie gerade einmal aktuelle Angebotsausfälle, die durch Probleme bei der Stromversorgung in der Inneren Mongolei und in der chinesischen Provinz Yunnan entstanden sind. Die auch in China zunehmende Fokussierung auf die Verringerung von CO2-Emissionen könnte zu weiteren Angebotseinschränkungen führen, da 80 Prozent der Produktionsstätten mit Kohle betrieben werden und zum Zwecke der Emissionsreduktion kurzfristig stillgelegt werden könnten. Schätzungen zufolge sollte die globale Produktion von Aluminium 2021 dennoch um sechs Prozent zunehmen. Die gesamte Nachfrage – sei es nach Autos, nach Fensterrahmen oder im Zuge des Ausbaus Erneuerbarer Energien nach Windrädern oder nach Tragekonstruktionen für Photovoltaikanlagen – dürfte allerdings um 8,9 Prozent steigen. Mit einem für die kommenden Jahre prognostizierten ansteigenden Angebotsdefizit dürfte der Aluminiumpreis weiteres Aufwärtspotenzial besitzen – mit den üblichen Schwankungen.