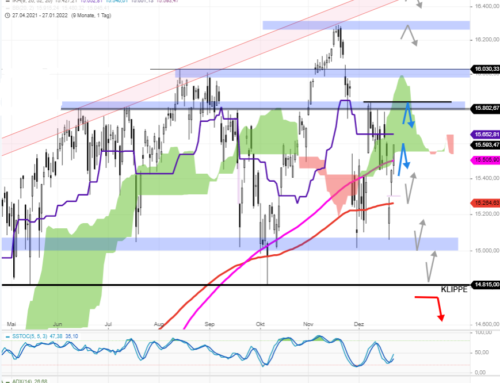„Value“-Titel sind im STOXX 600 stärker vertreten, Luxusgüter sind stark gefragt, und Hersteller für Auto-Chips weiten ihre Kapazitäten aus.
Europas verwunderliche Outperformance
Der STOXX 600 weist verglichen mit dem S&P 500 oder mit dem MSCI Emerging Markets eine höhere Gewichtung von Substanzwerten (engl. „Value“), Zyklikern und Finanzunternehmen auf. Entsprechend besser schneidet der Index in der Regel ab, wenn Konjunkturindikatoren und Kapitalmarktzinsen ansteigen. Bei fallenden Zinsen und langsamerem Wirtschaftswachstum liegt der STOXX 600 hingegen meist hinten. Deshalb mag es auf den ersten Blick verwundern, dass europäische Aktien in den vergangenen Wochen outperformt haben, obwohl die Renditen am US-Anleihemarkt gefallen sind und weltweit IT- sowie Qualitätstitel – die im STOXX 600 unterrepräsentiert sind – deutlich zugelegt haben. In meinen Augen liegt dies insbesondere daran, dass die Analysten ihre Gewinnprognosen zuletzt besonders für europäische Unternehmen angehoben haben – in den vergangenen drei Monaten um fast zehn Prozent –, was vom Markt mit Kursaufschlägen quittiert wurde. Zudem haben US-Anleger jüngst Interesse an europäischen Aktien gezeigt. In den vergangenen vier Wochen flossen über sechs Milliarden US-Dollar aus den USA in europäische Aktienfonds – so viel wie seit 2015 nicht mehr. Bleiben diese Faktoren bestehen, kann die Outperformance des STOXX 600 anhalten.
Boom bei europäischen Luxusgütern
Luxusgüter wie Schmuck, Uhren und Mode erfahren derzeit große Nachfrage. Im ersten Quartal lagen die Umsätze europäischer Luxusmarken acht Prozent über dem 2019er Niveau. Verantwortlich für die Entwicklung ist neben der gewohnt hohen Nachfrage aus China das boomende Geschäft in den USA. Dank Börsenhöchstständen und Konsumschecks stiegen die Umsätze mit Luxusgegenständen im ersten Quartal gegenüber 2019 um 43 Prozent. Im laufenden Quartal könnten die Branchenumsätze dank nunmehr geöffneter Boutiquen und Juweliere in Europa und anhaltender Kauflaune in den USA und Asien sogar noch etwas höher ausfallen. Experten rechnen im Vergleich zum zweiten Quartal 2019 mit einem Plus von knapp zehn Prozent. Am Markt scheinen mir diese Aussichten angesichts eines durchschnittlichen Kurs-Gewinn-Verhältnisses (KGV) von 40x für die prognostizierten Gewinne der kommenden zwölf Monate bereits größtenteils eingepreist zu sein. Zum Vergleich: 2019 lag das KGV „nur“ bei rund 21x. Interessierte Anleger sollten deshalb einen günstigeren Einstieg abwarten oder die Aktienmärkte der Eurozone in Erwägung ziehen. Hier stehen Luxustitel immerhin für knapp zehn Prozent und zyklische Aktien sind überdurchschnittlich hoch gewichtet.
Wachstum bei britischen Konsumgütern
Die Einzelhandelsumsätze im Vereinigten Königreich gingen im Mai gegenüber dem Vormonat unerwartet um 1,4 Prozent zurück, obwohl die Geschäfte seit Mitte April wieder geöffnet sind. Nach einem starken Zuwachs der Verkäufe von 9,2 Prozent im April war ein Rückschlag jedoch nicht unwahrscheinlich – trotz der schwachen Maizahlen liegen die Umsätze immer noch gut neun Prozent über dem Vorkrisenniveau. Außerdem haben viele Haushalte mehr Geld für Restaurant- und Pub-Besuche ausgegeben, nachdem auch die Innenräume der Gastronomie im Mai geöffnet wurden. Dennoch rechne ich mit einem kräftigen Wachstum der Ausgaben für Konsumgüter im weiteren Jahresverlauf. Der britische Arbeitsmarkt hat sich zuletzt deutlich besser entwickelt als erwartet; die Arbeitslosenquote liegt mit aktuell 4,7 Prozent um nicht einmal einen Prozentpunkt höher als Anfang 2020 und dürfte auch nach dem Auslaufen der Arbeitsmarkthilfen im September kaum steigen. Gleichzeitig haben die Haushalte in der Krise kräftig gespart und verfügen nun über eine entsprechend hohe Kaufkraft. Ich sehe daher Chancen für britische Konsumaktien – wie zum Beispiel Nahrungsmittelproduzenten, Tourismusanbieter sowie Medienunternehmen –, die angesichts einer relativ moderaten Bewertung und Kursentwicklung Aufholpotenzial gegenüber dem Gesamtmarkt haben dürften.
Kurzfristiger Gegenwind für Kupfer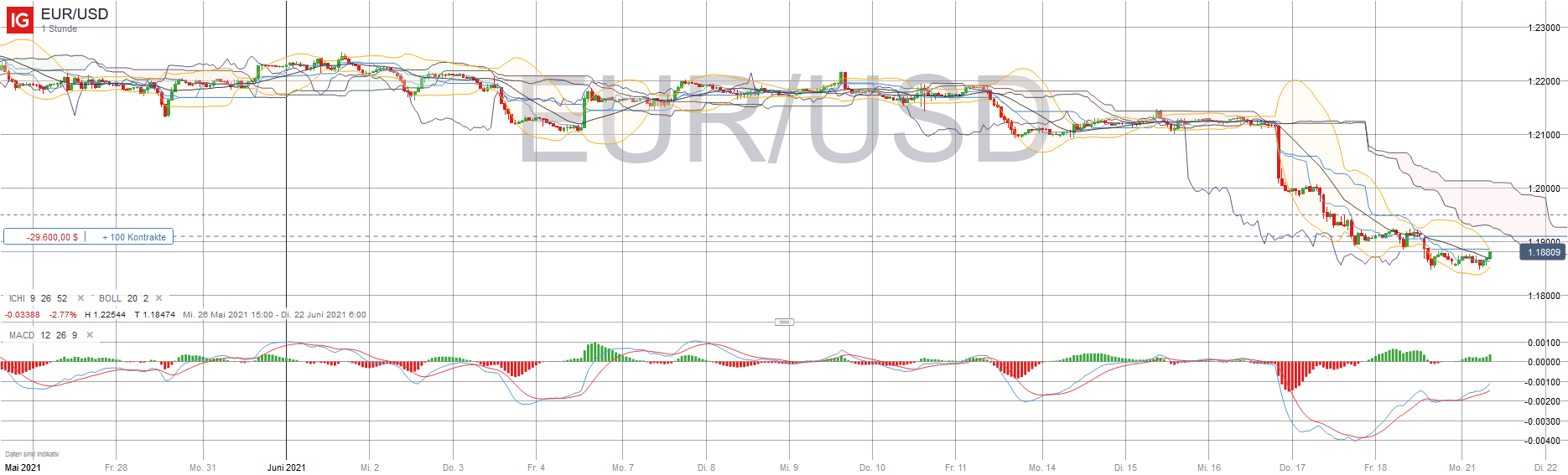
Die Kupferpreise erlitten vergangene Woche den stärksten Rücksetzer seit März 2020. Das rote Metall kam dabei von zwei Seiten unter Druck: Zunächst unternahm China weitere Schritte, um den Preisanstieg der Industriemetalle zu bremsen. Firmen des dortigen Staatssektors wurde nahegelegt, Kaufpositionen an den Terminmärkten abzubauen oder zu schließen. Erstmals seit 2005 kündigte China zudem an, dass Kupfer ebenso wie Aluminium und Zink aus den strategischen Reserven heraus an die heimischen Produzenten verkauft werden könnte. Hinzu kam die US-Notenbank Fed, nach deren Sitzung die Kupferpreise noch stärker abrutschten.
Auslöser hierfür war der starke Anstieg des US-Dollars, der Kupfer außerhalb des US-Währungsraums verteuerte, weshalb es sich in der Folge binnen drei Tagen um acht Prozent verbilligte. Kurzfristig könnten die Notierungen weiter unter Druck bleiben. Mittelfristig dürfte aber insbesondere wegen der starken, vom US-Dollar-Kurs unabhängigen Nachfrage aus den USA erneut Aufwärtspotenzial bestehen.