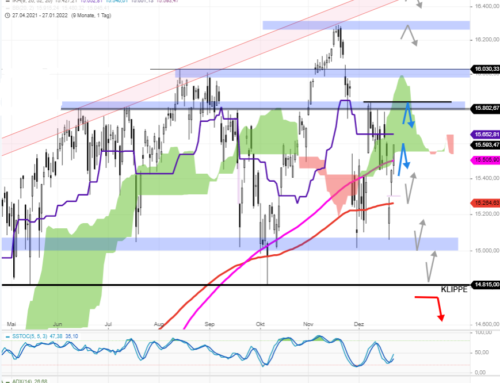Die US-Renditen steigen nach der US-Notenbanksitzung deutlich an, die Exporte mittel- und osteuropäischer Länder erholen sich von der Corona-Krise schnell, und die Grüne Transformation der Energiegewinnung erfordert erhebliche Anlageinvestitionen.
Nach der Fed-Sitzung: US-Renditen ziehen an
Die Renditen US-amerikanischer Staatsanleihen stiegen nach der US-Notenbanksitzung am Mittwochabend deutlich an; dies allerdings überproportional in den kurz- bis mittelfristigen Laufzeiten, wohingegen zehnjährige Staatsanleihen immer noch 0,2 Prozent unter dem Jahreshoch bei 1,77 Prozent Ende März rentieren.
Seit März sind ausländische Investoren als Käufer an die Märkte zurückgekehrt. Sie erwarben netto US-Staatsanleihen im Gegenwert von 50 Milliarden US-Dollar, verkauften aber gleichzeitig Anleihen mit kürzeren Laufzeiten als einem Jahr im Gegenwert von 129 Milliarden US-Dollar, um diese in längere Laufzeiten umzuschichten. Kapitalmarktzinsen für zehnjährige US-Staatsanleihen erscheinen bei rund 1,5 Prozent deutlich interessanter als 0,05 Prozent für japanische oder gar minus 0,2 Prozent für Bundesanleihen. Obgleich durch diese starke Nachfrage aktuell ein Renditeanstieg zehnjähriger US-Staatsanleihen abgebremst wird, sprechen vermutlich anhaltend hohe Inflationsraten nach Aufhebung der Pandemiebeschränkungen für ein mittelfristig deutlicher ansteigendes Kapitalmarktzinsniveau. Dies wäre mit entsprechenden Kursverlusten der Anleihen verbunden.
Exportboom in Mittel-/Osteuropa
Die Exporte mittel- und osteuropäischer Länder haben sich von der Coronavirus-Krise schnell erholt. Nach einem Einbruch von 20 Prozent im Frühjahr 2020 lagen die Ausfuhren im ersten Quartal 2021 schon wieder fünf Prozent über Vorkrisenniveau. Polen, Tschechien und Ungarn profitieren in hohem Maß vom Aufschwung im für sie wichtigsten Absatzmarkt Deutschland. Besonders stark entwickeln sich die Exporte elektronischer Ausrüstungsgüter. Die Ausfuhren von Lithium-Ionen-Akkus aus Polen haben sich im zweiten Halbjahr 2020 verdreifacht. Batterien für Autos und Handys sind inzwischen das wichtigste Exportprodukt des Landes, vor Maschinen und Autos. Obwohl die Pandemie hier für einen Nachfrageschub sorgte, dürfte der Trend zur Digitalisierung und Elektrifizierung auch langfristig große Wachstumschancen für die Elektroindustrie in Mittel- und Osteuropa beinhalten. Kurzfristig wird aber die Erholung bei exportierten Dienstleistungen – unter anderem im Tourismus-Sektor – für starkes Wachstum sorgen. Werden internationale Reisebeschränkungen zurückgefahren, sollte insbesondere Ungarn mit einem relativ hohen Anteil des Tourismus-Sektors von 6,7 Prozent der Wirtschaftsleistung profitieren. Trotz der bereits guten Kursentwicklung sehe ich in diesem Umfeld anhaltend positives Sentiment und noch Potenzial für die Aktienmärkte in Mittel- und Osteuropa.
Coronavirus sorgt erneut für Lieferengpässe
Selbst kleinere lokale Coronavirus-Ausbrüche haben immer noch das Potenzial, die globale Wirtschaft zu beeinträchtigen. Infolge neuer Beschränkungen in der südchinesischen Provinz Guangdong kommt es zu massiven Verzögerungen bei der Verladung von Schiffen. Anstelle der sonst üblichen 0,5 Tage warten Schiffe im Hafen von Shenzhen aktuell 16 Tage auf einen Ankerplatz. Das Risiko einer erneuten Störung globaler Lieferketten ist signifikant: Knapp ein Viertel aller chinesischen Exporte wird über die Provinz abgewickelt; zwei der weltweit größten Containerhäfen liegen in Guangdong. Die Verzögerungen können nicht nur zu Produktionsunterbrechungen in anderen Ländern führen – auch die Frachtraten dürften weiter ansteigen. Schiffstransporte von Asien nach Europa sind bereits rund sechsmal so teuer wie im Vorjahr, nachdem die Produktion von Containern und das Wachstum der Transportkapazitäten mit dem boomenden Welthandel kaum Schritt halten kann. Ein weiterer Anstieg der Produzentenpreise ist programmiert, schon heute liegen die Preise in den USA 6,6 Prozent und in Deutschland gut fünf Prozent über dem Vorjahresniveau. Die Sorgenfalten der Notenbanker und Markteilnehmer angesichts des weltweit steigenden Preisdrucks dürften vorerst nicht kleiner werden.
Gemischte Aussichten für Stahlproduzenten
Das Tempo der Grünen Transformation der Energiegewinnung nimmt weltweit zu und erfordert erhebliche Anlageinvestitionen. Schätzungen gehen allein für Europa bis 2030 von einem Ausbau der Leistung Erneuerbarer Energien von insgesamt 400 Gigawatt aus – und das unter Einsatz erheblicher Mengen von Stahl, ein paradoxerweise sehr CO2-intensiver Baustoff. Allein eine Fünf-Megawatt-Offshore-Windkraftanlage erfordert den Einsatz von 750 bis 1.250 Tonnen Stahl. Die zusätzliche Nachfrage wird allerdings naturgemäß mit zunehmender Fertigstellung der Anlagen abnehmen. Parallel dazu dürfte der Trend zum E-Auto – in das rund 150 Kilogramm weniger Stahl verbaut werden als in einen Pkw mit Verbrennungsmotor – die Stahl-Nachfrage zusätzlich reduzieren. Insgesamt könnten so allein in Europa bis 2030 rund 15 Millionen Tonnen Stahl weniger verbaut werden als 2019. Die langfristigen Wachstumspotenziale CO2-intensiver Stahlerzeuger halte ich daher für begrenzt, während die Marktanteile konkurrierender Unternehmen mit umweltschonenden Produktionsprozessen sogar steigen könnten.