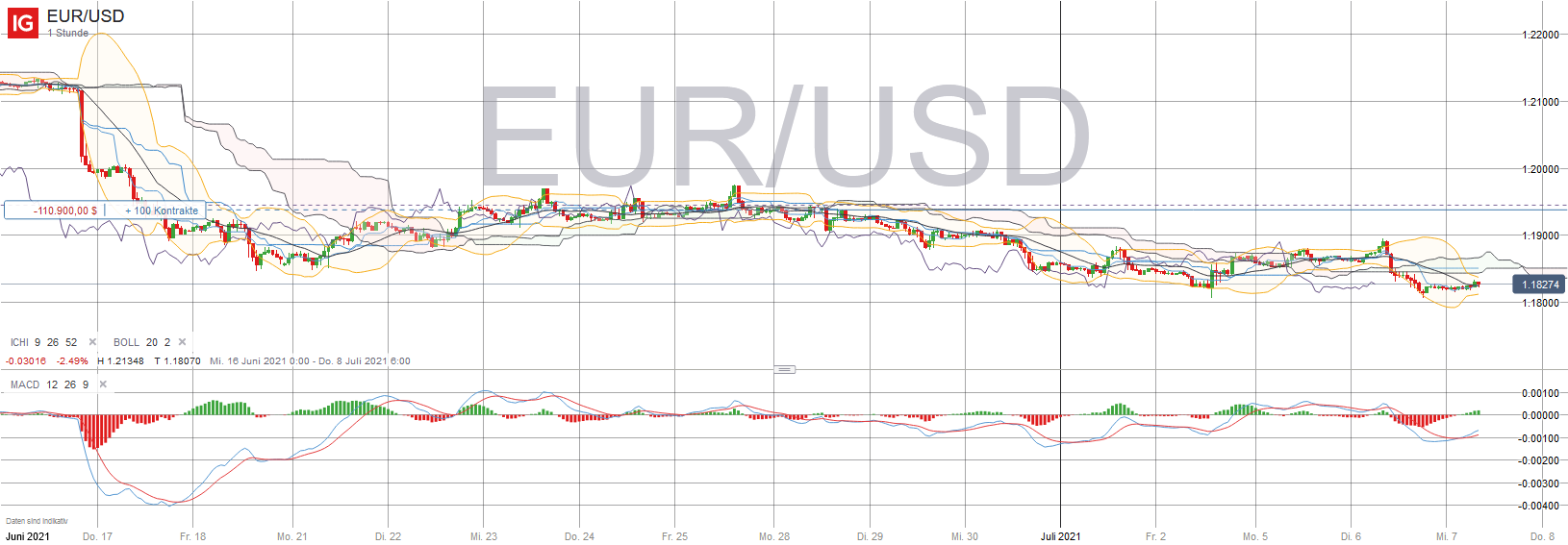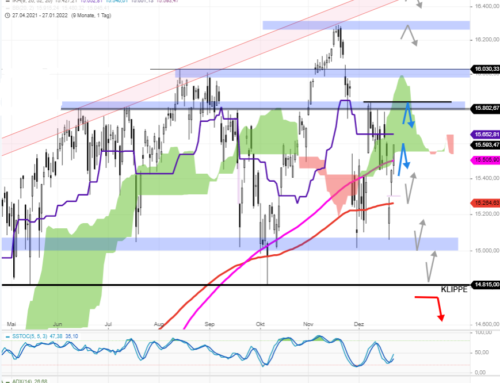Der Russell 2000 tritt seit Monaten auf der Stelle, am Ölmarkt droht eine wachsende Angebotslücke, und für Unternehmen der Schwellenländer wird ein hohes Gewinnplus erwartet.
US-Nebenwerte: Wohin geht die Reise?
Der US-Nebenwerte-Index Russell 2000 hatte das Jahr fulminant begonnen und bis Mitte Februar gut 16 Prozent zugelegt. Seither bewegt sich der Markt allerdings in einer engen Spanne seitwärts. Unter Anlagestrategen herrscht Uneinigkeit über die zukünftige Kursrichtung. Für eine erneute Aufwärtsbewegung sprechen die hohe Indexgewichtung zyklischer Sektoren wie Industrie, Banken oder Grundstoffe, der erwartete Anstieg der öffentlichen und privaten Investitionen sowie die vergleichsweise günstige Bewertung.
Seit 2002 wurde der Russell 2000 im Schnitt 43 Prozent teurer gehandelt als der S&P 500, derzeit liegt der Aufschlag nur bei 33 Prozent. Skeptiker verweisen indes auf die leicht abnehmende Wirtschaftsdynamik, hohe Kosten für Rohstoffe und Vorprodukte sowie erste Anzeichen wachsenden Lohndrucks. Letzteres ist besonders relevant, da kleine und mittelgroße US-Unternehmen – gemessen am Verhältnis von Mitarbeitern zu Umsätzen – im Schnitt doppelt so arbeitsintensiv produzieren wie Großkonzerne. Ich erwarte kein schnelles Ende der laufenden Debatte und kann mir vorstellen, dass sich die Konsolidierungsphase des Russell 2000 noch etwas fortsetzt. Die anstehende Berichtssaison könnte jedoch für Ausschläge sorgen, leider in beide Richtungen.
OPEC+ uneinig, Öl teuer
Nach dem Scheitern der Verhandlungen der OPEC+-Länder zogen die Preise für Öl zunächst deutlich an. Die US-Sorte WTI stieg zwischenzeitlich sogar auf ein Sieben-Jahres-Hoch, denn die geltenden Produktionsbeschränkungen dürften zunächst in Kraft bleiben. Kurzfristig könnten dadurch im August circa 2,5 Millionen Barrel Öl pro Tag zu wenig angeboten werden. Zunächst könnte die weiter steigende Nachfrage durch Lagerabbau teilweise gedeckt werden, die Bestände in den USA und in China sind allerdings schon deutlich gefallen. Erhöhen weder die US-Schieferölproduzenten noch die OPEC+ ihre Förderung, dürfte der Markt zum Jahresende ein Angebotsdefizit von fünf Millionen Barrel pro Tag aufweisen, bei einer täglichen Nachfrage von dann mehr als 90 Millionen Barrel. Zwar wären die Ölpreise verwundbar, falls der OPEC+-Bund sich auflösen, jedes Land so viel wie möglich fördern und somit ein Preiskampf wie Anfang 2020 ausbrechen würde. Zu vermuten ist allerdings eher, dass sich die OPEC+-Länder doch noch zusammenraufen und die Einschränkungen bei der Produktion aufrechterhalten. Öl könnte daher trotz der gestern einsetzenden Gewinnmitnahmen im US-Handel auch in den kommenden Wochen auf hohem Preisniveau handeln.
Schwellenländer: Berichtssaison in den Startlöchern
Nächste Woche beginnt in den Schwellenländern die Berichtssaison für das zweite Quartal. Dabei wird ein durchschnittliches Gewinnwachstum in US-Dollar von 47 Prozent gegenüber dem Vorjahr erwartet. Überdurchschnittlich starke Umsatz- und Ertragszahlen dürften Unternehmen aus Saudi-Arabien, Brasilien und Chile verzeichnen, deren rohstoffsensible Volkswirtschaften besonders vom Rohstoffboom der vergangenen Monate profitieren. Einige Unternehmen könnten ihre Gewinne sogar um das Achtfache gegenüber dem Vorjahr steigern – allerdings bedingt durch zum Teil sehr niedrige Vorjahreszahlen. Dagegen haben viele Unternehmen aus China, Taiwan und Indien schon 2020 starke Gewinnzuwächse erzielt. Daher ist die erwartete Gewinnsteigerung für Unternehmen der Schwellenländer Asiens von im Schnitt 34 Prozent durchaus beachtlich. Die Rohstoffexporteure Lateinamerikas dürften nach wie vor von hohen Rohstoffpreisen profitieren, wenngleich politische Unsicherheiten auch Kursrisiken bergen. Den breiter diversifizierten asiatischen Aktienmärkten traue ich im Zuge der globalen wirtschaftlichen Erholung etwas mehr Potenzial zu.
China-Anleihen stark gefragt
Notenbanken sind dank großvolumiger Ankaufprogramme zu einem bedeutenden Investor für heimische Anleihen geworden. Aber die Währungshüter halten auch in erheblichem Umfang Devisenreserven, meist in Form ausländischer Staatsanleihen. Diese Reserven wachsen stark und belaufen sich weltweit inzwischen auf rund zwölf Billionen US-Dollar. Mit einem Anteil von 60 beziehungsweise 20 Prozent sind US-Dollar und Euro mit Abstand die beiden wichtigsten Reservewährungen. Weil Zentralbanken zunehmend auf die Rendite ihrer Reserven achten, hat der Anteil der meist höher verzinsten Schwellenländerwährungen zuletzt aber zugenommen. Vor allem chinesische Anleihen sind angesichts der Marktgröße und einer Rendite von gut drei Prozent bei zehnjähriger Laufzeit für die Portfoliomanager der Notenbanken interessant. Ich schätze daher, dass sich der Anteil chinesischer Staatsanleihen an den gesamten Devisenreserven von aktuell 3,4 Prozent in den kommenden fünf Jahren etwa verdoppeln wird. Die höhere Nachfrage durch Zentralbanken könnte auf lange Sicht nicht nur die Kurse chinesischer Bonds, sondern auch den Renminbi stützen.