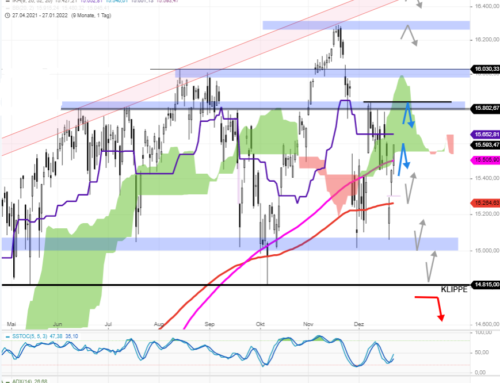US-Großkonzerne sind in der Anlegergunst gefallen, Europas Finanzhäuser überraschen positiv, und Asiens Lockdowns drücken die Ölnachfrage.
Wall-Street-Giganten schwächeln
er Aktienindex NYSE FANG+ liegt seit Jahresbeginn in Euro mit einem Prozent im Minus. Verantwortlich sind mehrere Faktoren. Das Ende der Pandemie in den größten Wirtschaftsnationen ist in Sicht. Anleger haben sich deshalb in den zurückliegenden Monaten von Krisengewinnern aus der Internet- und IT-Branche getrennt und ihre Portfolios zyklischer aufgestellt. Gleichzeitig könnten Spekulationen über höhere Unternehmen- bzw. Kapitalertragsteuern zu vereinzelten Gewinnmitnahmen geführt haben. Zudem sind viele Unternehmen im FANG+ überdurchschnittlich zinssensibel. Entsprechend sacken ihre Kurse häufig ab, wenn die Renditen am Rentenmarkt anziehen – wie zum Beispiel in der vergangenen Woche. In meinen Augen kann die Konsolidierung der Mega Caps aus den genannten Gründen durchaus noch etwas anhalten. Langfristige Investoren sollten sich davon jedoch nicht aus der Ruhe bringen lassen. Denn die enormen Investitionen der Konzerne sprechen dafür, dass ihr wichtigster Kurstreiber – das elitäre Gewinnwachstum – überdurchschnittlich bleiben wird. 2020 gaben allein die fünf größten US-Konzerne insgesamt 128 Milliarden US-Dollar für Forschung und Entwicklung und 104 Milliarden für Ausrüstungsinvestitionen aus.
Belasten US-Einkaufsmanager die Märkte?
Die Wachstumsdynamik in den USA dürfte ihren Höhepunkt schon überschritten haben. Die fiskalische Unterstützung war im ersten Quartal am größten, die Impfkampagne ist weit fortgeschritten und die Coronavirus-Beschränkungen wurden weitgehend zurückgefahren. Daher dürfte auch der ISM-Einkaufsmanagerindex den Höchststand mit 63,8 Punkten im März erreicht haben.
Nach einem leichten Rückgang im April könnte sich der Abwärtstrend im Mai fortsetzen. In der Vergangenheit war der Kursanstieg des S&P 500 mit durchschnittlich 1,5 Prozent in einem Monat dann am stärksten, wenn der ISM gestiegen ist. Das heißt aber nicht, dass der Aufschwung am Aktienmarkt nun beendet sein muss. Selbst bei einem fallenden Stimmungsbarometer betrug der Kurszuwachs immerhin noch 0,5 Prozent – solange der ISM über 50 Punkte lag, sogar 0,7 Prozent. Meines Erachtens sollte ein Rückgang des ISM die Märkte auch dieses Mal nicht allzu sehr belasten. Denn das US-Wachstum verlangsamt sich von einem außerordentlich hohen Niveau aus. Viele andere Länder stehen erst am Beginn einer Erholung, was auch den exportorientierten US-Unternehmen helfen sollte. Zudem dürfte die Geldpolitik in den USA länger locker bleiben als in vorangegangenen Aufschwüngen.
Europas Banken gut in Form
Europäische Banken haben im ersten Quartal überraschend gute Ergebnisse erzielt. Bei den Vorsteuergewinnen übertrafen mehr als 90 Prozent der Finanzhäuser die Analystenschätzungen – im Schnitt um 24 Prozent. Dies ist zwar vor allem darauf zurückzuführen, dass die Banken weniger Rückstellungen für Kreditausfälle gebildet haben als erwartet. Jedoch lagen dank hoher Einnahmen aus Gebühren auch die Umsätze rund fünf Prozent über den Prognosen. Die Nettozinseinkommen fielen niedriger aus als im Vorjahr. Mehrere Finanzinstitute äußerten sich angesichts einer Versteilerung der Zinsstrukturkurve und der anziehenden Kreditnachfrage aber optimistisch, dass sich das Kreditgeschäft im Jahresverlauf verbessern wird. Ich werte die starken Quartalsberichte als Bestätigung meiner Einschätzung: Der Sektor ist in guter Verfassung, um vom europäischen Konjunkturaufschwung der kommenden Jahre zu profitieren. Trotz Kursplus von 27 Prozent seit Jahresbeginn zähle ich Bankaktien deshalb weiter zu meinen Favoriten.
Pandemie in Asien bremst Ölpreise
Während viele Metalle neue Allzeithochs erklimmen, handeln die Ölpreise beständig unter ihren Anfang März erzielten Niveaus. Öl der Sorte Brent scheiterte zweimal knapp an der Marke von 70 US-Dollar je Barrel. Hauptverantwortlich ist das Aufflammen der Covid-19-Pandemie in vielen asiatischen Ländern. In Japan wurden Lockdown-Maßnahmen auf einige weitere Präfekturen ausgedehnt, in Singapur neue Beschränkungen beschlossen. Am schlimmsten ist weiterhin Indien betroffen. Der dortige Gesundheitsminister hält die Verlängerung einiger Lockdown-Maßnahmen um sechs bis acht Wochen für möglich. Für das zweite Quartal erwartet die OPEC+ einen Nachfrageausfall aus Indien von 300.000 Barrel pro Tag. Mit dem Fortschreiten der Impfkampagne in den USA und Europa und weiterhin robuster Nachfrage aus China könnte die globale Nachfrage nach Öl jedoch bis zum Ende des dritten Quartals um vier Millionen auf dann knapp 98 Millionen Barrel ansteigen. Die Seitwärtsbewegung der Preise könnte somit kurzfristig noch etwas anhalten; mittelfristig besitzen die Ölpreise weiteres Potenzial.