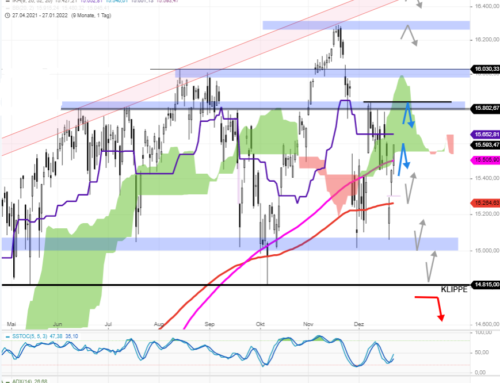Die höheren Ölpreise wirken sich auf die Aktienkurse vieler Konzerne unterschiedlich aus, die Industrieproduktion in den USA hinkt den Aufträgen seit Jahresbeginn hinterher, und die wirtschaftliche Erholung Mexikos verliert an Schwung.
S&P 500: Energiekonzerne verlieren an Gewichtung
Ölpreise können sich auf unterschiedlich auf die Aktienkurse vieler Konzerne auswirken. Während Ölkonzerne von den höheren Preisen profitieren, belasten die gestiegenen Energie- oder Rohstoffkosten die Unternehmen anderer Sektoren. Zusätzlich kann die Nachfrage nach Produkten und Dienstleistungen sinken, wenn Haushalte wegen höherer Energie- und Spritpreise auf Konsum verzichten müssen. Analysten zufolge hatten diese gegensätzlichen Effekte in der Vergangenheit einen leichten positiven Einfluss auf die durchschnittlichen Erträge der Konzerne des S&P 500. Die Gewinne pro Aktie des Index wuchsen für jeden zehnprozentigen Anstieg des Ölpreises durchschnittlich um 0,3 Prozent. Jedoch hat im Laufe der Zeit die Gewichtung der Energiekonzerne abgenommen, sodass diese nur noch vier Prozent der diesjährigen erwarteten Gewinne ausmachen dürften. Entsprechend könnte der knapp 70-prozentige Ölpreisanstieg seit Anfang des Jahres ohne erkennbaren Nettoeffekt auf die durchschnittlichen Profite der Unternehmen des S&P 500 an den Anlegern vorbeiziehen. Um dem entgegenzuwirken, könnten Investoren den Energiesektor höher gewichten. Dieser ist auf Basis der erwarteten Gewinne in den kommenden zwölf Monaten mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis von 13 bewertet.
USA: Arbeitskräftemangel bremst die Industrie
In den USA hinkt die Industrieproduktion den Aufträgen seit Jahresbeginn um etwa fünf Prozentpunkte hinterher. Fehlende Halbleiter sind dabei nicht der einzige Grund für die gedämpfte Entwicklung des Outputs. Knapp 30 Prozent der Unternehmen berichten über fehlende Arbeitskräfte; fast eine Million Stellen im Verarbeitenden Gewerbe sind aktuell unbesetzt. Auch im Transportsektor gibt es zu wenige Arbeitskräfte, was zu einer Unterbrechung von Lieferketten in vielen Industriebranchen führt. Mit sinkenden Infektionszahlen sollte sich die Lage entspannen, da zahlreiche Arbeitskräfte an den Arbeitsmarkt zurückkehren und die krankheitsbedingten Ausfälle zurückgehen werden. Die Industrieproduktion könnte 2022 um gut 100 Milliarden US-Dollar steigen, wenn gleichzeitig auch die Engpässe bei Halbleitern erkennbar abnehmen. Ich erwarte für den Sektor im kommenden Jahr daher noch einmal kräftige Ertragszuwächse. Anleger sollten aber die schon relativ hohe Bewertung von Industrieunternehmen in den USA im Auge behalten.
Welche Rolle Rohstoffe im Portfolio spielen könnten
Zu Zeiten hoher Inflationsraten stellt sich für Anleger die Frage, in welcher Größenordnung Rohstoffe in Portfolios berücksichtigt werden sollten. In der Dekade des Ölpreisschocks zwischen Anfang 1970 und Ende 1979 hätten Anleger zu realen Preisen – also unter Berücksichtigung der Inflation – Gewinne in der Größenordnung von rund 20 Prozent pro Jahr mit Gold und Öl erzielen können. Mit US-Aktien und US-Staatsanleihen wären zeitgleich Verluste in Höhe von 1,5 Prozent beziehungsweise von 1,2 Prozent pro Jahr zu verzeichnen gewesen. Betrachtet man die realen Erträge jedoch von Anfang Oktober 2021 aus rückblickend für 10, 25, 50 und 100 Jahre, haben Anleger, die in US-Aktien investiert hatten, in jedem dieser Zeiträume mindestens 6,5 Prozent Rendite erzielt. Auch für zehnjährige US-Staatsanleihen, US-Immobilien und Kupfer stehen für alle vier Zeiträume geringe reale Gewinne zu Buche, während Gold im Zehnjahreszeitraum marginal verloren hat. Die meisten anderen Rohstoffe zeigen aber eine schwache Wertentwicklung über lange Zeiträume hinweg. Der 19 Rohstoffe umfassende CRB-Index (Commodity Research Bureau) hätte über alle vier Zeiträume hinweg reale Verluste generiert. Historisch betrachtet gibt es somit keine Alternative zu Aktieninvestments, wobei Gold immerhin seinem Ruf als „Versicherung“ gegen Rückschläge an anderen Märkten oft gerecht wurde.
Mexiko: Erholung der Wirtschaft gerät ins Stocken
Die wirtschaftliche Erholung Mexikos verliert momentan an Schwung. Zwar scheint die dritte Covid-19-Welle ihren Höhepunkt überschritten zu haben. Allerdings halten 23 von 32 Bundesstaaten weiterhin Corona-Beschränkungen aufrecht. Eine landesweite Impfquote von gerade einmal 35 Prozent lässt deren Fortführung befürchten. Infolge der Chipknappheit exportierte Mexiko bis Ende August 20 Prozent weniger Autos als im Vergleichszeitraum 2020. Zudem haben steigende Preise für Benzin und für Lebensmittel die Inflationsrate Ende September auf sechs Prozent getrieben, was den Konsumenten weniger Freiraum für anderweitige Konsumgüter lässt und weitere Zinserhöhungen der Notenbank nach sich ziehen dürfte. Mit Fiskalhilfen in Höhe von gerade einmal einem Prozent des Bruttoinlandsprodukts hat Mexikos Regierung wesentlich weniger zur Stützung der Wirtschaft beigetragen als andere Schwellenländer. Der Leitindex MEXBOL notiert aktuell nur knapp vier Prozent unter seinem Rekordhoch vom 1. September.